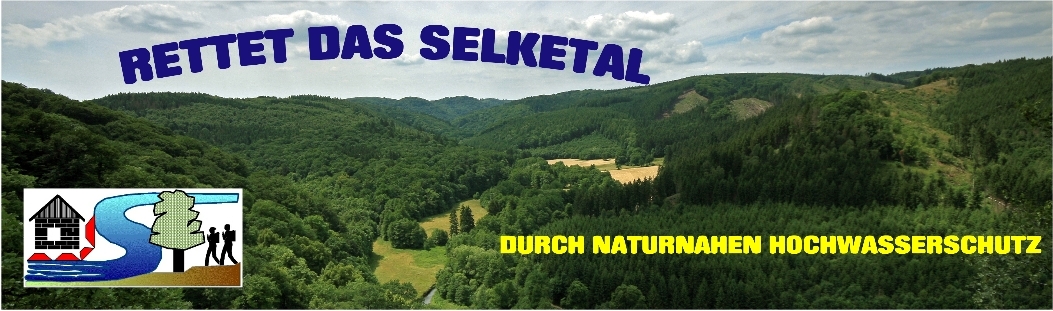Auf der Grundlage der Studie
"Untersuchungen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Selke" der DRESDEN DORSCH CONSULT
Ingenieurgesellschaft mbH vom 31.05.1999 sowie der
"Untersuchungen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes durch ein
Hochwasserrückhaltebecken
in der Selke oberhalb Straßberg - Ergänzende Untersuchungen der Varianten VIII
und IX" vom 30.11.2000
erarbeitete der LHW seinen HW-Aktionsplan
Landesbetrieb für
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen- Anhalt
Magdeburg, 18. Dezember
2002
(erarbeitet als Vorlage für
die Landesregierung)
Hochwasser-Aktionsplan Selke
Die Punkte 1, 2, 4 und
5 hier im Wortlaut (ohne Skizzen):
1. Veranlassung, Bezug zum HW-Aktionsplan Bode
Ein
großer Teil der an der Selke liegenden Siedlungsgebiete ist stark
hochwassergefährdet und war während des Hochwassers vom April 1994 weiträumig
überflutet. Auf der Grundlage der bereits vorliegenden Untersuchungsergebnisse
in der Flussgebietsstudie Bode (HGN) wurden für das Flussgebiet der Selke in den
vergangenen Jahren umfassende Untersuchungen zu Möglichkeiten einer Verbesserung
des Hochwasserschutzes durchgeführt. Ausgehend von einer Analyse der
Hochwasserentstehung und des Hochwasserablaufes sowie der im Einzugsgebiet
bestehenden Hochwasserrückhalteräume wurden verschiedene Varianten des
Hochwasserschutzes mit und ohne Schaffung zusätzlicher Rückhalteräume
betrachtet.
Ausgehend von der Wirksamkeit überregionaler Maßnahmen zum Hochwasserrückhalt
wurden ebenfalls notwendige örtliche Maßnahmen zum unmittelbaren Schutz der
Ortslagen ermittelt. Bei den Untersuchungen sind Hochwasserereignisse HQ (50),
HQ (100) sowie das im April 1994 abgelaufene Hochwasser berücksichtigt worden.
Die Kosten-Nutzen-Relation der Maßnahmekombinationen/Maßnahmen wurde bewertet
und im Ergebnis Vorzugsvarianten aufgezeigt.
Die Aufgabenstellung des HW-Aktionsplanes Bode bzgl. der Selke lautete:
„Für
die Selke ist im Rahmen einer Studie der hydraulische Nachweis für effektive
Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich der Ortslagen zu führen. Dabei sind sowohl
Maßnahmen des örtlichen als auch des überregionalen Hochwasserschutzes unter
Einbeziehung der Harzteiche zu untersuchen."
Zur
Erfüllung und als Grundlage des HW-Aktionsplanes Selke liegen u.a. folgende
Untersuchungen vor:
• Untersuchungen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes an der Selke
— Studie — DDC (22. Mai 1999);
• Kurzfassung zu o.a. Studie, DDC (31. Mai 1999);
• Untersuchungen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes durch ein
Hochwasserrückhaltebecken in der Selke oberhalb Straßberg, DDC, (30. November
2000);
• Umsetzung der Selkestudie „Untersuchungen zur Erweiterung des
Hochwasserrückhaltes und Ableitung Gesamtkonzeptes zum Hochwasserschutz im
Einzugsgebiet der Selke", DDC (31. August 2002)^
Der HW-Aktionsplan Selke baut besonders auf der „Umsetzung der Selkestudie" auf.
Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt legt
hiermit einen prioritär geordneten Aktionsplan vor.
2. Das Selke-Hochwasser vom April
1994
2.1 Das Flussgebiet der Selke
Die
Selke ist mit einer Länge von 64,4 km zwischen dem Quellgebiet im Mittelharz
(ca. 510 m ü. HN) und der Mündung einer der Hauptnebenflüsse der Bode. Einen
Übersichtsplan des Einzugsgebietes zeigt Abbildung 1. Hinsichtlich der
Grundstruktur können zwei Laufabschnitte unterschieden werden.
• Der Oberlauf umfasst die Selke von der Quelle bis zum Pegel
Meisdorf. Dieser Laufabschnitt kann außerhalb der Ortschaften als naturnah
bewertet werden; er weist ausgeprägte Strukturen und eine erhaltenswerte
ökologische Vielfalt auf. Die ökologische Durchgängigkeit wird durch einige
Querbauwerke sowie streckenweise ausgebaute Bereiche innerhalb der Ortslagen
beeinträchtigt. Unterhalb von Güntersberge durchfließt die Selke ein 150 bis 200
m breites Sohlental. Zwischen Alexisbad und Mägdesprung engt sich das Tal ein
(Kerbtal) und weitet sich erst unterhalb des Vierten Friedrichhammers wieder
auf.
• Der Selkeunterlauf zwischen Meisdorf und der Mündung in die Bode
weist deutliche Beeinträchtigungen des Flusses durch Ausbaumaßnahmen
(Begradigungen, Sohleintiefungen, ...) auf. Die ökologische Durchgängigkeit ist
durch eine Reihe von Wehren beeinträchtigt. Mit dem Eintritt in das Harzvorland
unterhalb von Meisdorf weitet sich die Talaue stark auf; sie ist zwischen
Gatersleben und der Mündung in die Bode etwa 1 km breit.
Harzteiche im Einzugsgebiet der Selke
Im
Einzugsgebiet der Selke befinden sich 29 künstliche Teiche und Stauhaltungen,
die im Zuge der Entwicklung des Bergbaus im Mittel- und Unterharz angelegt
wurden. Die Teiche stellen potentielle Hochwasserrückhalteräume dar.
Wehre
Die
Funktion der mehr als 20 Wehre im Flussabschnitt besteht in der Regel in der
Wasserstands- und Durchflussregulierung der abzweigenden Mühlgräben sowie in der
Gefälleregulierung. Überwiegend handelt es sich um feste Wehre; abschnittsweise
bewegliche Wehre mit Schütztafeln befinden sich nur in Gatersieben und Hoym
sowie an Mühlgrabeneinläufen.
Brücken
Die
Selke wird zwischen dem Auslauf Mühlenteich in Güntersberge bis zur Mündung in
die Bode von ca. 90 Brücken gequert. Die Konstruktion reicht von einfachen
Betonstegen, über Holzbrücken bis hin zu alten Bogenbrücken mit mehrfachen
Öffnungen.
2.2 Meteorologisch-hydrologische Situation 1993/1994
Als
Hochwasserentstehungsgebiet im Einzugsgebiet des Wasserlaufes Bode ist in erster
Linie der Harz mit den Teileinzugsgebieten der Kalten und Warmen Bode, der
Rappbode, der Selke und Holtemme zu nennen.
Überwiegend treten Hochwasser, hervorgerufen durch intensive Schneeschmelze,
(Tauwetter, Regen auf Schnee) als Winterhochwasser auf (z.B. 1925/26, 1965/66,
März 1981).
Auslöser für Regenhochwasser ist meist die zyklonale Westlage bzw. das Tief
Mitteleuropa (klassische V-b-Lage). Hier werden Niederschlagssummen bis 100 mm
in 24 h erreicht.
Sommerhochwasser, hervorgerufen durch Stark- bzw. Dauerregen mit großen
Intensitäten, treten seltener in Erscheinung und umfassen in der Regel auch nur
Teilbereiche des Gesamteinzugsgebietes (z.B. Juni 1981 im Holtemmegebiet). (Juni
2002 Holtemme, Ilse, Großer Graben)
Die Vorbelastung der Einzugsgebiete zu Beginn eines Niederschlagsereignisses
(Schneerücklage, Bodensättigung) sowie das mögliche Zusammentreffen von
HW-Spitzen der Bode und Nebenwasserläufe sind wesentliche Faktoren für die Höhe
und den Ablauf von Hochwässern im Bodegebiet.
Die hohen Niederschläge der Monate Dezember 1993 bis März 1994 hatten die
Aufnahmekapazität des Bodens erschöpft. An Straßeneinschnitten sickerte das
Wasser flächenhaft aus den Böschungen. Mulden und Gräben waren gefüllt, Flüsse
und Bäche waren nach vorangegangenen Ausuferungen gerade wieder in ihr
natürliches Bett zurückgekehrt, an der unteren Bode bestanden noch großflächige
Ausuferungen.
Vom 10. bis 13. April 1994 beeinflussten aus dem Mittelmeerraum nach Norden
ziehende Tiefs mit ihren Ausläufern Sachsen-Anhalt. Am Dienstag, dem 12. April
1994 griffen in der 2.Tageshälfte ergiebige Niederschläge eines hochreichenden
Tiefs mit Kern über Tschechien vor allem auf Thüringen und den Harz vor. Die von
Norden einströmende Kaltluft glitt auf die feuchtwarme Luft aus dem
Mittelmeerraum auf und führte insbesondere auch über dem Harz zu erheblichen
Niederschlagsmengen, da hier die niederschlagsbildenden Prozesse besonders
intensiv und lange wirkten.
2.3 Hochwasserverlauf April 1994
Im
gesamten Einzugsgebiet der Bode fielen zwischen dem 09. bis 14. April 1994 etwa
250 bis 300 Millionen Kubikmeter Regen. Davon entfallen etwa 45 bis 50 Millionen
auf das Gebiet der Talsperren und wiederum davon 30 bis 35 Millionen auf die
Warme und Kalte Bode. Da die Aufnahmekapazität des Bodens erschöpft war, kam
davon ein besonders hoher Anteil zum Abfluss.
Am 12. April 1994 setzte in den späten Abendstunden ein Starkregen ein, der an
den meisten Stationen im Harz bis zum 13. April, 08:30 Uhr, Ergiebigkeiten von
mehr als 80 I/m² brachte.
Ohne die sonst üblichen Konzentrationszeiten kam es zu steilen
Wasserstandsanstiegen an den beobachteten Pegeln. In den Oberläufen des Harzes
wurden an nahezu allen Pegeln die bis dahin höchsten bisher beobachteten
Wasserstände überschritten.
Der Scheiteldurchfluss im Selkegebiet erfolgte im Oberlauf am 13. April 1994 mit
nie zuvor beobachteten Durchflusswerten zwischen 70 und 80 m³/s. Es kam zu
großen Ausuferungen. Insgesamt erreichten die Scheitelwerte von Selke und
Holtemme die Bode vor deren Spitzendurchfluss, der durch den Einfluss des
TS-Systems verzögert worden war.
Das zwischen dem 12. April 1994 und dem 14. April 1994 in der Selke abgelaufene
Hochwasser erreichte Scheiteldurchflüsse, die an allen drei Pegeln in der
Größenordnung eines HQ (200) lagen. Ab Güntersberge nahm das Hochwasser die
gesamte Talbreite ein und führte in den Siedlungsgebieten Straßberg,
Silberhütte, Alexisbad und Mägdesprung zu hohen Schäden. Der Scheiteldurchfluss
nahm bis Meisdorf weiter zu und erreichte hier Spitzenwerte von 110 m3/s. Im
Selkeunterlauf breitete sich das Hochwasser in der Talaue aus; es bildeten sich
teilweise weit verzweigte Flutrinnen und die Ortslagen waren großräumig
überschwemmt. Durch die Ausbreitung des Hochwassers und die Füllung der
Retentionsräume kam es zu einer wesentlichen Verminderung des
Scheiteldurchflusses bis Hausneindorf.
2.4 Hochwasserschäden und deren Bewertung
Für die
Ortslagen der Selke wurde 1998/99 eine Ermittlung der Schäden des
Aprilhochwassers 1994 durchgeführt. Als Gesamtwert für die erfassten
Hochwasserschäden ergaben sich 53,526 Mio DM.
Insgesamt muss eingeschätzt werden, dass die vorliegenden Informationen zu den
Hochwasserschäden hinsichtlich Vollständigkeit und Genauigkeit sehr
unterschiedlich sind. Insbesondere die extrem niedrigen Schadenshöhen in
Hausneindorf und Hedersleben stehen im Widerspruch zur Größe der überschwemmten
Siedlungsfläche. Die Ursache liegt offensichtlich in einer unvollständigen
Erfassung der aufgetretenen Schäden. Eine ähnliche Situation wird für die
Ortslage Hoym vermutet. Aufgrund der teilweise bestehenden Lücken muss man davon
ausgehen, dass der tatsächliche Schaden den ermittelten Wert übersteigt.
(3. Grundsätze des HW-Schutzes im Selkegebiet)
4. HW Aktionsplan
4.1 Empfehlungen zur
weiteren Vorgehensweise aus den Studien
Eine Verbesserung
des Hochwasserschutzes an der Selke kann nur durch die Kombination einer Auswahl
von allen möglichen Maßnahmekomplexen effizient gestaltet werden:
1. Primär zu realisieren sind die überregional wirksamen und
effizienten Maßnahmen zur Erweiterung der Hochwasserrückhalteräume im
Selkeoberlauf. Ausgehend von den vorliegenden Untersuchungsergebnissen ist
folgende Prioritatenreihung vorgesehen:
Kurzfristige Maßnahmen:
Änderung der Bewirtschaftung und Vergrößerung der Hochwasserrückhalteraume in
folgenden vorhandenen - Talsperren.
- Frankenteich
- Kiliansteich
- Fürstenteich (Umwandlung in ein grünes Rückhaltebecken) Teufelsteich
Planungsbeginn des Rückhaltebeckens Straßberg
Um eine optimierte Steuerung der einzelnen Rückhalteanlagen zu ermöglichen, ist
der Einbau von Meßeinrichtungen und die Schaffung der Möglichkeit einer
Fernübertragung der Daten erforderlich. Bestandteil der Maßnahmen ist in jedem
Fall die Ertüchtigung der Bauwerke an den Harzteichen. Entsprechend den
durchgeführten Untersuchungen ist insbesondere für den Rödelbach in der Ortslage
Straßberg ein Ausbau in Form einer hydraulisch günstigen Trassenführung
erforderlich.
Mittelfristige Maßnahmen:
Planung und Bau des HRB Straßberg
> Für den Standort oberhalb Meisdorf sollte eine abschließende Klärung
hinsichtlich einer Realisierbarkeit erfolgen, da die Hochwassersicherheit für
den Selkeunterlauf dadurch nachhaltig verbessert und auf örtliche Maßnahmen im
Selkeunterlauf nahezu komplett verzichtet werden könnte. (vgl. 4.2)
Langfristige Maßnahmen:
- Planung und Bau des HRB Uhlenbach
Dieser Maßnahme wird keine zeitliche und inhaltliche Priorität zugeordnet.
2. Parallel zu Erweiterung des Rückhaltevermögens sollten ausgehend von
den ermittelten und aufgezeigten Defiziten im Hochwasserschutz lokale
wasserbauliche Maßnahmen zur Erhöhung des bestehenden Schutzgrades in den
Ortslagen durchgeführt werden. Dabei ist auf eine Angemessenheit der Maßnahmen
zu achten und nach Möglichkeit eine Aufwertung des gewässerökologischen
Zustandes anzustreben.
Bei einer Realisierung der unter Punkt 1 genannten Maßnahmen ohne ein HRB
Meisdorf weisen folgende Ortslagen hohe Defizite hinsichtlich des
Hochwasserschutzes auf und sollten kurz bis mittelfristig durch örtliche
wasserbauliche Maßnahmen geschützt werden:
|
Unterlauf |
- Meisdorf
- Ermsleben
- Reinstedt
- Hoym
- Gatersleben
- Hedersleben
- Hausneindorf |
Realisierung nur,
wenn RHB Meisdorf
im HW Aktionsplan keine Bestätigung erfährt. |
Im Oberlauf sind örtliche
wasserbauliche Schutzmaßnahmen für die Ortslagen Güntersberge, Alexisbad und
Mägdesprung unumgänglich zur Einhaltung des Schutzzieles HQ 100.
Im Rahmen dieses HW Aktionsplanes erfolgt die Festlegung des Schutzgrades unter
Berücksichtigung des lokalen Schadenpotentials und im Zuge durchzuführender
vergleichender Planungen. Im Selkeunterlauf müssen außerhalb der Ortslagen sowie
in unbebauten Bereichen weiträumige Ausuferungsbereiche wasserrechtlich
gesichert werden, um Aufhöhungen der Scheiteldurchflüsse durch den Verlust an
Retentionsräumen auszuschließen. Die Maßnahmen zum Hochwasserschutz sollten für
alle Bereiche akzeptabel sein und unvermeidbare negative Nebeneffekte minimiert
werden. Die Beurteilung der Maßnahmen orientiert sich an der
gesamtwirtschaftlichen Nutzenmaximierung.
3. Als Ergänzung ist eine Verminderung der potentiellen Hochwasserschaden
durch folgende begleitende Maßnahmen anzustreben.
> administrative Maßnahmen¬
- Nutzungsbeschränkungen (Festsetzung von Überschwemmungsgebieten)
- Freimachen und Freihalten von gefährdeten Flächen,
d.h. Umsiedlung, Beseitigung von Abflußhindernissen etc.
- Bauvorschriften für gefährdete Objekte
> lokale (Bau)maßnahmen
- lokale Eindeichung von Einzelobjekten
- Mindesthöhenlage der Nutzgeschosse von Bauwerken
- äußere und innere Schutzvorkehrungen bei Einzelobjekten
- überflutungs und auftriebssichere Gestaltung wichtiger Anlagen
> Hochwasserverteidigung
- Hochwasserwarndienst und detaillierte Einsatzpläne, eine Vergrößerung
der Vorwarnzeit soll z.B. durch den Bau eines zusätzlichen Pegels
oberhalb der Ortslage Güntersberge erreicht werden.
- HW Warnung aus Niederschlagsvorhersage
- Sicherungsmaßnahmen, Bereitstellung von Material (z.B. Sandsäcke)
4.2 Die Vorzugsvariante aus der Sicht des Landesbetriebes für
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW)
Die Umsetzung des Hochwasseraktionsplanes Selke erfordert eine enge
Zusammenarbeit des LHW mit dem Talsperrenbetrieb des Landes Sachsen Anhalt (TSB).
Der LHW sieht seine bisherigen Auffassungen durch die Empfehlungen gem. Pkt. 4.1
hinsichtlich der kurzfristigen Maßnahmen der Nutzung der bestehenden Harzteiche
für den Hochwasserschutz bestätigt.
Ausgehend vom Kosten Nutzen Verhältnis und der Gegenüberstellung des
Naturraumverbrauches gibt der LHW dem Bau der grünen Rückhaltebecken Straßberg
und Meisdorf den Vorrang vor dem Ausbau von Ortslagen im Selkegebiet unterhalb
Meisdorf. Der Bau/die Erweiterung des RHB Uhlenbach ist optional zu betrachten
und hängt von der weiteren Entwicklung bzw. Fortschreibung des HW Aktionsplanes
ab.
5. Begründung für die Entscheidung
der Vorzugsvariante aus der Sicht des LHW
Hinsichtlich der Kostenrelevanz ist die für das RHB Meisdorf so, daß Baukosten
für das RHB in Höhe von 6,6 Mio. € Ausbaukosten in den Ortslagen Meisdorf,
Ermsleben, Reinstedt, Hoym, Gatersleben, Hausneindorf und Hedersleben in Höhe
von ca. 15,5 Mio. € zur Erreichung der gleichen Zielstellung gegenüberstehen.
Bezüglich des Naturraumverbrauches steht einem dauerhaften Flachenverbrauch für
das grüne Dammbauwerk in Meisdorf von ca. 8000 m² mit ökologisch ertüchtigtem
Grundablaß eine Flächeninanspruchnahme für die u.h. liegenden 7 Ortslagen (und
Eingriffen in 4 weitere Nebengewässer, Mühlgraben u.Ä.) in Höhe von ca. 160.000
m² als Eingriff gegenüber.
Maßnahmen in den Ortslagen greifen darüber hinaus massiv in
Eigentumsverhältnisse, gültige Wasserrechte an Mühlgraben und Nebengewässer,
regionale Entwicklungsmöglichkeiten techn. Infrastruktur (Straße, Bahn) und
landwirtschaftliche Flächennutzungen auch außerhalb derzeitiger
Überschwemmungsgebiete ein. Zu beachten ist weiterhin, daß Sauerbach,
Klostergraben, Getel und Hauptseegraben ebenfalls in die Selke u.h. des
Rückhaltebeckenstandortes Meisdorf einmünden und bei Beschränkung auf einen
Ortslagenausbau wasserbaulich ebenfalls zur Verhinderung von Hochwasserrückstau
auszubauen waren. Es müßten zusätzlich 2 Flutmulden von 4,5 und 8,5 km Länge
angelegt werden, wobei die Scheiteldurchflüsse bei Hochwasser im Interesse des
Schutzes der Siedlungen von oben nach unten erhöht werden würden und der
Durchfluß insgesamt als stark ungleichförmig zu betrachten wäre.
Die dezentralen Maßnahmen in den Ortslagen ohne das Rückhaltebecken Meisdorf
haben in der Gesamtbetrachtung keinerlei nachhaltige Wirkung, schränken die
Entwicklungsmöglichkeiten inner und außerorts ein und geben keine Gewähr einer
dauerhaften Verbesserung des HW Schutzniveaus; sie stellen eine end of pipe
Lösung dar.
Der Hochwasserlängsschnitt der Selke zeigt eindrucksvoll den Sicherheitsgewinn
des RHB Meisdorf für die unterhalb liegenden Ortslagen, der den noch unterhalb
Mägdesprung anzutreffenden Durchfluß von ca. 50 m³/s abbaut.
Das Kernstück für den HW Schutz im Selkegebiet ist die Schaffung von
Voraussetzungen zum Rückhalt von Wasser durch den Bau der RHB Straßberg und
Meisdorf.
Die ökonomischen bzw. ökologischen Parameter stellen hier ein Optimum dar.
|